Fela Kuti: „Coffin for Head of State“ (1980)
„Them steal all the money
Fela Kuti: Coffin for Head of State
Them kill many students
Them burn many houses
Them burn my house too
Them kill my mama“
Gleich 1000 Soldaten der nigerianischen Armee sind angerückt, um ein Anwesen in einem Armenviertel der Hauptstadt Lagos zu stürmen. Am 18. Februar 1977 prügeln sie auf die knapp 100 Leute ein, die dort leben, vergewaltigen Frauen und brennen am Ende die Gebäude ab. Der Angriff gilt dem Musiker Fela Kuti. Auf dem Gelände lebt er mit seinen 27 Frauen, mit Musikern und Familie, sein Bruder betreibt hier eine Klinik, die Arme gratis behandelt. Kuti nennt den Ort die Kalakuta Republic. Die Soldaten stoßen Kutis 78-jährige Mutter, die im Haus gegenüber wohnt, aus einem Fenster im ersten Stock.
Fela Kuti überlebt den Übergriff schwer verletzt. Doch alles, was er besaß, wird ein Opfer der Flammen: sein Haus, sein Tonstudio, der berühmte Club „The Shrine“, von dessen Bühne er bei den Auftritten seiner Band regelmäßig Korruption, Unterdrückung und Armut angeprangert hatte. Schon oft hatte die Polizei Kuti unter verschiedenen Vorwänden festgenommen. Doch die Armee? Im Song „Zombie“ hatte er sie als Ansammlung seelenloser Befehlsempfänger verspottet. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Dass sie nun mit Gewalt gegen ihn vorgeht, ist eine neue Dimension.

Kuti, in einem strengen christlichen Mittelklasse-Elternhaus aufgewachsen, ist während eines USA-Aufenthaltes zum politischen Musiker geworden. Seine Geliebte Sandra Izsadore hat ihm die Memoiren von Malcolm X in die Hand gedrückt und ihn mit der Bürgerrechtlerin Angela Davis bekannt gemacht. Kuti entwirft die Idee einer afrikanischen Musik, die an den Soul und Funk James Browns anknüpft: lange, sich wiederholende Rhythmuspassagen, von Bläsersätzen gespielte Melodiesegmente, der Gesang setzt spät ein. Die Stücke dauern live oft bis zu einer Stunde. „Afrobeat“ nennt Kuti die Richtung.
Kuti ist Sänger, Saxophonist, Tänzer, Komponist, Agitator und ein begnadeter Performer. Aber auch ein widerborstiger Star, der sich dem Musikbusiness verweigert. Kutis Texte sind politisch, direkt und entschieden, er singt meist in nigerianischem Pidgin. Er sieht die christlichen wie auch die muslimischen Eliten im postkolonialen Nigeria als durch Assimilation entfremdet und kämpft für ein vereinigtes Afrika, das seine Kraft aus den eigenen Traditionen und Religionen schöpft. Abgestoßen von der revolutionären Parole „Der Kampf geht weiter“ wählt er sein Credo: „Der Kampf muss aufhören!“
Doch danach sieht es in Nigeria nicht aus. Das Land an der Küste Westafrikas ist 1960 unabhängig geworden, nur um zu erleben, wie die Macht in die Hände korrupter Militärregierungen übergeht. Kutis Mutter Funmilayo Ransome-Kuti ist eine Aktivistin. Sie war die erste Frau in Nigeria, die Auto fuhr. Als Frauenrechtlerin hat sie die DDR bereist und in China Mao die Hand geschüttelt. Ein Jahr nach dem Armee-Überfall auf Kalakuta stirbt sie an den Folgen des Fenstersturzes.

Fela will ein Zeichen setzen. Als die Amtszeit des Präsidenten Oluṣẹgun Ọbasanjọ endet, zieht er mit einem symbolischen Sarg vor die Dodan-Baracken in Obalende, die Präsidentenresidenz. Die Wachsoldaten richten ihre Gewehre auf ihn und seine Begleiter. Kuti lässt den Sarg von seinen 27 Frauen langsam Richtung Eingang tragen und fragt: „Wollt Ihr wirklich auf Frauen schießen?“ Seine Botschaft: Präsident Obasanjo und Vizepräsident Yar’Adua waren für den Tod der Mutter Kutis verantwortlich, sie sollen den Sarg zu sich nehmen und damit ihre Schuld eingestehen.
Stattdessen veröffentlicht die Regierung einen Bericht über den Angriff auf die Kalakuta-Republik, indem sie die Schuld an dem Brand einem „fehlgeleiteten, unbekannten Soldaten“ zuschiebt. Kuti schreibt darüber zwei Songs: In „Unknown Soldier“ verspottet er den Regierungsbericht über den Anschlag. Und im zwanzigminütigen „Coffin for Head of State“ demaskiert er sich gottesfürchtig gebende Despoten, christliche wie islamische, die das eigene Volk ausrauben. Den Präsidenten und seinen Vize nennt er namentlich.
(Text: Martin Kaluza, Juli 2017)

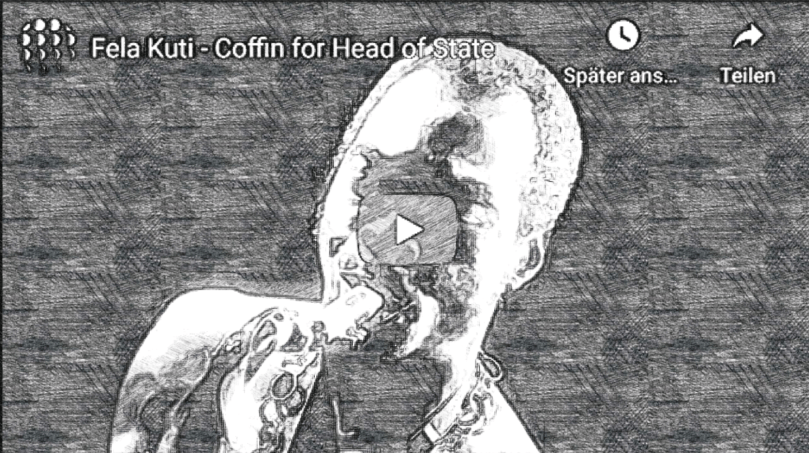
















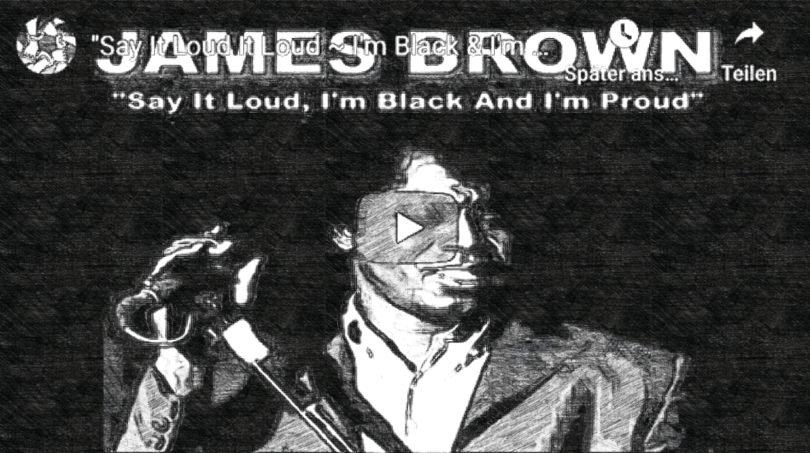

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.